www.rockinberlin.pl
Menu g³ówne:
Europ. Musikszene
Deutsche Seite
"Spiel, wie es dir gefällt!"
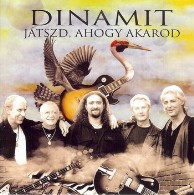
DINAMIT präsentieren explosiv geladene Musik
In den letzten Jahren hat Rockinberlin regelmäßig die neuesten CDs von SBB vorgestellt. Werfen wir in der folgenden Beschreibung aber mal einen Blick darüber hinaus. Sind doch die Musiker der wohl ältesten und erfolgreichsten polnischen Blues-, Jazz- und ProgRockband SBB auch noch in anderen Musikprojekten tätig. Neulich kam Post aus Budapest. Absender: Gábor Németh - der ungarische Schlagzeuger, seit einigen Jahren SBB-Mitglied, schickte uns kurzerhand die neue CD, die er mit seiner ungarischen Band Dinamit veröffentlichte. Titel der neuen Scheibe: Játzsd, ahogy akarod, was so viel heißt wie: "Spiel, wie es dir gefällt!" Auf einer ganz anderen musikalischen Wellenlänge angesiedelt als SBB, geht es auf dem ungarischen Album hart zur Sache. Der Ursprung liegt musikalisch eindeutig und hörbar in den siebziger Jahren. Es ist typischer Hardrock mit kompromisslosen Gitarrenriffs und erinnert an die Musik der seinerzeit auch Polen bekannten Band Skorpió. Genauer genommen ist es die Nachfolgeband, explosiv geladen, wie es der Name verspricht. Neben Gábor Németh ist beispielsweise der Gitarrist Gábor Szücs Antal (unter anderem Ex-Skorpió), Bruder der ebenfalls in Polen bekannten Sängerin Judith Szücs, mit von der Partie. Hart, aber mit auffällig melodischen Klängen präsentieren Dinamit ein Album, mit dem sie sich gleich selbst übertroffen haben: "Es ist unser bestes Album und wir sind stolz darauf." Es ist die bislang dritte Scheibe der Gruppe, die bereits seit 1979 existiert.
www.dinamitegyuttes.hu
Dinamit
Játszd, ahogy akarod
Rockinform
Volker Voss
ZSUZSA KONCZ

Die berühmte ungarische Chanson-, Schlager- und Popsängerin ZSUZSA KONCZ im Interview mit Volker Voss am 28. Februar 2008
Sie haben ein sehr breitgefächertes Repertoire an Musik. Zu DDR-Zeiten wurden Sie als Schlagersängerin bekannt, hatten aber zuvor schon mit Omega und Illés gespielt. János Bródy schrieb und schreibt für Sie sehr anspruchsvolle Texte. Sie haben Lieder mit Gedichten des ungarischen Nationaldichters Attila József im Programm. Wie würden Sie Ihr künstlerisches Schaffen selbst bezeichnen?
Ich würde mich als Sängerin bezeichnen, die anspruchsvolle Lieder singen kann, will und muss, und die versucht, ihre Gedanken dem Publikum mitzuteilen. Ich sehe mich nicht als erfolgreichen Star. Das ist zwar als Begleiterscheinung sehr schön und angenehm, aber nicht meine eigentliche Intention. Nicht ohne Grund habe ich damals ein Jurastudium begonnen, ich wollte wissen, wie man das Zusammenleben der Menschen verträglicher gestalten kann und mich aktiv daran beteiligen. Wenn man jung ist, will man die Welt verändern und ist voller Idealismus. Eine gerechtere Welt mittels Jura - das war mein Programm. Dass ich dann aber doch einen anderen Weg gewählt habe, ist den Texten von János Bródy geschuldet, der die meisten meiner Lieder schreibt und darin von unserer Sicht auf die Dinge, auf das Leben erzählt, mit einer Sprachgewalt, die es vermochte, unsere Gedanken und Gefühle, unsere Erfahrungen und Erlebnisse, also unser Innerstes, unsere Seele, widerzuspiegeln. Wir hofften, dass einige Menschen daran ebenso interessiert sein könnten wie wir. Das war der Fall, es ist sogar ein sehr großes Publikum in Ungarn für diese Lieder vorhanden, und so hatten wir beschlossen, das auch richtig ernsthaft zu machen.
Wie fing es damals in den 1960er Jahren mit dem Beat in Ungarn an?
1965 gab es erste ungarischsprachige Aufnahmen von Illés. Dann kam so ab 1966 der Durchbruch, auch mit Omega, dann später mit Metro. Bis dahin hatten sie nur als Amateure gespielt. Das war die Zeit, als die ungarische Schallplattenproduktion langsam anlief Dann interessierten sich auch die Medien dafür. 1967 erschien die erste ungarische Rock-LP, damals noch Beat genannt.
War das die Platte "So ist die Jugend"?
Das war ein Album mit der Musik des Filmes "So ist die Jugend/Ezek a fiatalok". Das war zugleich ein Spielfilm mit dokumentarischem Wert. Er dokumentiert die Zeit, als Omega, Illes und Metro der Durchbruch in Ungarn gelang - ein Musikfilm mit diesen drei Bands, mit mir und unserer Musik. Er war gerade beim jungen Publikum sehr beliebt und ist mittlerweile zu einem Klassiker geworden. Ich bin darin die Hauptdarstellerin.
Das war die Zeit der Beatles. Haben Sie damals daran mitgewirkt, den Beat in Ungarn populär zu machen, als Sie mit Omega, Illés und Metro auftraten?
Ja, das war unsere Musik damals. Ich hörte auch die Beatles gern. Ich freute mich natürlich über die Einladung von Omega, mit ihnen einen Titel in Englisch aufzunehmen.
Es hat mir neben dem Gymnasium einen Riesenspaß gemacht. Ich war damals ein kleines, sechzehnjähriges Mädchen und war nicht so selbstständig, wie es in der heutigen Zeit üblich ist. Denn nach meiner Teilnahme an dem TV- Wettbewerb Anfang der sechziger Jahre "Wer weiß was" erzielte ich einen Landeserfolg und wurden mit einem Schlag berühmt. Sicherlich half meine Popularität auch den Jungs von Omega ein wenig. Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
Beat war zunächst in Ost und West verpönt, wie war es damals in Ungarn?
Das war anfangs sehr ambivalent. Es gab eine ganze Generation von Eltern, die diese langen Haare hassten: "Wie die aussehen und wie die schreien", sagten sie. Genauso wie im Ausland. Aber so ab Ende der sechziger Jahre gewöhnte sich die ungarische Gesellschaft daran.
Viele Rockkonzerte sollen nur mit einem riesigen Polizeiaufgebot möglich gewesen sein.
Es gab in Ungarn verschiedene Bewertungen von Kultur und der Staat hatte eben die Deutungshoheit darüber, was Kultur ist und was nicht. Da gab es einerseits die staatlich unterstützte Kunst, andererseits die geduldeten Künste und Künstler und die verbotenen. Wir befanden uns in dieser Zeit ständig im Spannungsfeld zwischen geduldet und verboten, mal wurden wir verboten, mal ereilte uns die Gnade der Duldung, mit dem Resultat eines riesigen Polizeiaufgebots. Im Sommer traten wir mit Wes auf großen Open Air-Festivals auf, beispielsweise am Balaton oder in Debrecen. Es kam schon mal vor, dass das Polizeiaufgebot größer war als das Publikum. Hätten wir darauf bestanden, ohne Polizei zu spielen, so hätten wir überhaupt nicht auftreten dürfen.
Es soll bei Illés auch Festnahmen durch die Polizei gegeben haben?
1973 fand in Miscolc das erste ungarische Rockfestival mit allen ungarischen Rockbands statt. Es war viel Polizei da, die sich während des Konzerts aber sehr zurückhielt. Doch anschließend nahm sie János Brody (Gitarrist, Songschreiber und Sänger bei Illés) fest.
Er hatte sich bei den Ordnungskräften für die Aufrechterhaltung der Ordnung bedankt. Das Publikum lachte, klatschte und pfiff, da am Abend zuvor die eingetroffenen Fans festgenommen und eingesperrt wurden. Der Einsatzleiter der Polizei sah in den Bemerkungen Br6dys eine Anspielung und Untergrabung staatlicher Autorität. Das war für uns der Beginn einer sehr schweren Zeit. Bródy stand zwei Monate unter Hausarrest. Es gab eine Hausdurchsuchung, eine öffentliche Anklage mit Gefängnisandrohung. Doch dann passierte nichts. Nur meine LP erschien nicht, weil Bródy alle Texte geschrieben hatte. Erst zehn Jahre später konnte das Album "Zeichensprache!Jelbeszed" veröffentlicht werden.
Gab es eine Begründung?
Nein. Der Chef der Plattenfirma äußerte lediglich, die Platte ist nicht zugelassen. Mehr erfuhren wir nicht. Wir wussten aber den wahren Grund, es ging nämlich um Bródy und die Vorfälle um ihn.
Sie haben in der DDR auch viele deutsche Lieder gesungen, die leichten Schlager hatten nichts mit den aussagekräftigen Texten in Ungarn zu tun. Gefiel Ihnen das?
Ich würde das so beurteilen: Ich wurde vom DDR-Fernsehen zu Auftritten eingeladen.
Vorher wurden aus einer Liste Lieder ausgewählt und dazu deutsche Texte geschrieben, die sehr, sehr vereinfacht den ungarischen Inhalt wiedergaben, so dass vom Original kaum etwas übrigblieb. Dazu gab es die verschiedensten Begründungen. Angefangen von den unterschiedlichen "Realitäten" in beiden Ländern über die Schwierigkeiten der Sprache bis hin zur Zensur. Zwar gehörten die beiden Staaten politisch dem gleichen Lager an, doch war bei uns ein größerer Spielraum möglich. Es fehlte wohl auch der Wille, sich die Mühe zu machen, den eigentlichen Textinhalt ins Deutsche zu übertragen. Hinzu kommt, dass ich auf Grund meiner damals noch nicht so guten deutschen Sprachkenntnisse erst viel später merkte, was aus meinen Liedern gemacht wurde. So konnte es dann vorkommen, dass bestenfalls der Titel eines Liedes dem ungarischen Original entsprach.
Es sind im Ausland Alben von Ihnen mit teilweise sehr unterschiedlichen Namen erschienen. Mal hießen Sie Jana Koncz, mal Shusha Koncz. Waren Sie damit einverstanden?
(Lacht) Nicht immer! Das wurde anfangs teils ohne mich entschieden, so beispielsweise in Bezug auf Jana. Ich war eine Anfängerin. Die Plattenproduktion war noch neu für mich.
Ich habe keinen gut klingenden Namen, auch nicht im Ungarischen. Koncz ist ein sehr hartes Wort, aber so heiße ich nun mal. Und weil ich in Ungarn mit dem Namen bekannt geworden bin, wollte ich ihn irgendwie auch im Ausland bewahren. Heute sagen sie oft "Kontsch" statt "Kontz", wie es richtig gesprochen ist. Ich weiß, es ist nicht leicht, und ich verbessere das nicht immer.
Wie beurteilen Sie die aktuelle ungarische Musikszene?
Da gibt es einige ernsthafte Versuche, auch auf dem internationalen Markt anzukommen, gerade im Bereich der Welt- und Folkmusik. Es gibt in diesem Bereich eine Reihe sehr guter Musiker, die diese Musik auch leben. Wie sich alles entwickeln wird, kann man schwer voraussagen, etwas Glück gehört sicherlich mit dazu, die Aufmerksamkeit auf sich zu fokussieren. Dazu wäre ein international tätiges Management notwendig. Wir sind aber nur ein kleines Land mit gerade mal zehn Millionen Einwohnern.
Mal abgesehen davon, dass deutschsprachige Musik zur Zeit einen Aufwind in Deutschland erlebt, haben unsere Künstler einen schwierigen Stand bei den Medien.
Wie ist es in Ungarn? Oder anders: Wie findet Zsuzsa Koncz in den ungarischen Medien statt?
Es ist wenig Interesse vorhanden, die privaten Fernsehstationen in Ungarn haben nicht eine einzige Musiksendung im Programm. Interviews und überhaupt Auskunft über mein privates Leben kann ich bei denen geben, nur zu singen brauche ich nicht. Nur wenn ein neues Album erscheint, wird über DUNA TV das große Budapester Konzert zur Album-Veröffentlichung übertragen. Das staatliche Fernsehen dagegen ist zwar interessiert, doch das schaltet kaum jemand ein. Bei den meisten Radiostationen sieht es nicht viel anders aus, da ist eher Trend-Musik angesagt, doch es gibt einige Spartenprogramme, auf die ich zählen kann. Aber insgesamt gesehen ist die Situation nicht besser als in Deutschland. Es gab vor zwei Jahren eine Kulturkonferenz in Paris, an der ich als Delegierte teilnahm. Dort traf ich u.a. Herbert Grönemeyer, der über die gleichen Probleme sprach, die die nationalen Künstler offensichtlich überall in Europa haben.
Natascha Osterkorn singt russische Liebeslieder

"Immer gut drauf"
Natascha Osterkorn, die bekannteste Interpretin russischer Zigeunermusik im deutschsprachigen Raum, stellt ihre neue CD "always happy" in der Berliner Kulturbrauerei vor. Kaum betritt sie die Bühne, steigt die Stimmung im voll besetzten Saal. Sie lässt einen musikalisch teilhaben an dem einfachen, zeitlosen Leben der Roma in ihrer russischen Heimat, sucht den direkten Kontakt zum Publikum, lässt mitsingen. Es geht um Liebe, Mädchen und Heirat. Temperamentvoll, romantisch, mal wehmütig, mal spaßig, auf Russisch gesungen, mit kleinen Späßen auf Deutsch, präsentiert sie ihre Songs. Aber so richtig übersetzen lässt sich das aus dem Russischen nicht.
Der Konzertbesucher taucht in die fantasievolle, verträumte Welt der russischen Zigeuner ein, den angenehmen Dingen des Lebens zugewandt, dem Alltag eher entschwunden: "Begegnet ein Mann einer schönen Frau, will er sie sofort heiraten. Das ist ganz anders als in Deutschland". So romantisch und so spontan besingt sie das Zigeunerleben. Allen Widrigkeiten zum Trotz: "Was immer passiert, der Russe ist immer gut drauf". Vadim Kulitskii und Oljég Matrosov, "beide am Lagerfeuer geboren", begleiten sie musikalisch mit ihren Gitarrenklängen. Doch Zigeuner können auch anders: Während die beiden Gitarristen sonst mit äußerster Konzentration die anspruchsvollen russischen Melodien spielen, begibt sich Vadim Kulitskii überraschend, stilbruchartig auf musikalische Abwege und stimmt auf seiner Gitarre Deep Purples "Smoke on the Water" an. Ein Seitenblick von Natascha deutet an, dass dies möglicherweise nicht unbedingt die passenden Klänge sind. Der Seitenblick mit leichtem Lächeln wurde verstanden und so folgten wieder die gewohnten Klänge der russischen Zigeuner. Klangabweichende Wiederholungen ließen sich während des Konzerts jedoch nicht vermeiden.
Text & Foto: Volker Voss
RIBLJA ÈORBA mit erstem unpolitischen Album

Scharf gewürzte serbische Fischsuppe
Von den Fans geliebt, von den Behörden verdammt, so war der Stand der serbischen Rockband Riblja Èorba (Fischsuppe) in Ex-Jugoslawien. Songtextbeispiel aus den 80ern: "Lieber Gott, gib mir einen schwarzen Mercedes, denn er ist eine wahre Traumkarre. Es ist so schön über Blumen und Menschen zu fahren". Solche und ähnliche Texte waren nicht selten der Stein des Anstoßes. 31 Jahre Bandgeschichte haben sie auf dem Buckel, eine Erfolgsgeschichte mit vielen Wechselbädern: Verbotsanträge gegen Veröffentlichungen, die nicht durchkamen, aber mit dem Resultat explodierender Verkaufszahlen, überfüllte Konzertsäle, schlagzeilenträchtige Tumulte und Strafverfahren wegen ihrer kritischen, aber auch obszönen Texte.
Sie gehörten mit Azra und Bijelo Dugme zu den Topbands der einstigen Yugo-Rockszene. Dann der (vorübergehende) Niedergang. Grund dafür: Bandleader Bora Ðorðeviæ (57) nahm während des Balkankrieges in den 90er Jahren eine sehr nationalistische Haltung ein, obwohl er andererseits aktiv die Proteste gegen die damalige Miloeviæ-Regierung unterstützte. Viele wandten sich ab. In den übrigen ex-jugoslawischen Republiken war die Band gar unerwünscht. Es gab Konzertabsagen. Ðorðeviæ`s Haltung in den 90ern war eher zwiespältig. Die Zeiten haben sich jedoch geändert, die Wogen haben sich geglättet. Mittlerweile können sie wieder auf ein volles Tourprogramm in allen ex-jugoslawischen Republiken und im Ausland verweisen, zählen wieder zum Mainstream. Ihr 26. Album, Minut sa njom (Eine Minute mit ihr), eher eine Abkehr von der Politik, ist das erste ohne politische Texte, ein stilistischer Querschnitt von Rock, Hard Rock, Metal und Blues. Stilistisch hat sich über die Jahre nicht viel geändert. 2004 gab es noch eine unerwartete Überraschung: Ðorðeviæ mutierte zum stellvertretenen serbischen Kulturminister, was aber nicht lange anhielt. Denn Rocker bleibt eben Rocker. Also geht`s munter rockig weiter. (vov)
www.riblja-corba.com
VODKU spielen aus Freude und Kummer

"Einfach nur schöne Musik machen"
"Natürlich wollen wir lustig sein, aber aus unserer Seele kommen auch die traurigen Dinge heraus. Wir verhalten uns so wie der Ungar beim Trinken. Man trinkt aus Freude, aus Kummer oder einfach nur so. Das machen wir mit der Musik genauso", erzählt István Bata, Sänger und Gitarrist der ungarischen Band Vodku. Ihr Repertoire: Mittel- und osteuropäische Volksmusik auf Ukrainisch, Griechisch, Ungarisch und Jiddisch gesungen, dazu ein Schuss Jazz und Rock. "Wir sind Musiker unterschiedlicher Herkunft: Folk- und Rockmusiker oder mit klassischem Hintergrund, setzen konventionelle Instrumente wie Schlagzeug, Gitarre, Bass ein und verwenden ebenso traditionelle wie Klarinette, Violine, Saxophone. Indem wir alles mixen, entsteht unser Stil. Das ist eine harte Arbeit. Man muss viel Bier dabei trinken. Die Texte schreibe ich, weil die anderen noch nichts mitgebracht haben. Mit der Musik ist es so, dass manchmal jemand mit einer ganz frischen Melodie kommt. Ansonst setzen wir uns zusammen und einer von uns findet eine interessante Melodie. Dann arbeiten wir so lange daran, bis sie zu uns passt", erläutert István spaßig das Bandkonzept. Genauer genommen stammt der Bandname von Wodka ab.
Seit 17 Jahren gibt es die siebenköpfige Band, anfangs traten sie in kleinen Clubs auf. "Die Leute fanden Gefallen an unserer Musik. Dann wurden wir mal hier, mal da eingeladen. So waren wir eine Band, die einfach eingeladen wurde. Das war uns erst gar nicht bewusst." Heute haben sie ein volles Programm, tourten bereits durch zehn Länder. Während ihrer 18-tägigen Mexikotour 2009 sind sie insgesamt 15-mal aufgetreten, erzählen sie voller Stolz. Im Sommer sind sie in Ungarn und in den Nachbarländern regelmäßig auf den vielen Openair-Festivals zu sehen, spielen auch oft am Plattensee.
Leider berichten die ungarischen Medien nicht über World Music, klagen sie. Ihre Devise für die Zukunft: "Wir werden weiterhin CDs rausbringen, auch ins Ausland gehen. Wir werden die Welt nicht erobern, auch nicht verändern, aber schöne Musik machen."
Text & Foto: Volker Voss
www.myspace.com/vodku